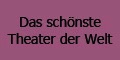Veit Relin
Österreicher von Geburt – Franke aus Liebe
Ein Selbstportrait für eine knappe Stunde
Würzburger Radio-Abend im Mainfränkischen Museum
Aufzeichnung am 21. Oktober 1994
gesendet am 30. Oktober 1994, 22.05-23.00 Uhr in Bayern 2
"Ich bin so unwichtig, wie ein Grashalm", hat der große Maler Oskar Kokoschka einmal in einem Interview von sich gegeben. Erlauben Sie mir, daß ich mich, was mich betrifft dem OK anschließe!
Daß Sie es, liebe Freunde und Franken hier mit einem echten "Zerrissenen" zu tun haben, soll Ihnen ein Vorwort beweisen, zu dem mich der Direktor der Wiener Museen der Stadt Wien Ende 1991/92 gezwungen hat:
"…Er soll gar nicht so schlecht sein…"
Es war um die 50er Jahre, als in Wien das Bonmot kursierte: "Als Schauspieler soll er gar nicht so schlecht sein", sagten die Maler – und die Schauspieler antworteten: "Eigentlich soll er, sagt man, ein recht guter Maler sein"! Besagtes Vorurteil hat sich auch im Laufe meines Lebens hartnäckig "gehalten", obwohl ich bereits 1957 mit 50 Maler-kollegen – unter hunderten ausgewählt – auf der Biennale der jungen Malerei in Paris vertreten war, und an ersten deutschen Theatern den Romeo, Don Carlos, Troilus, Gyges, Titus Feuerfuchs, den Zerrissenen und gottweißwas noch spielte.
Schon früher, noch mehr heute im Zeitalter der Fachidiotie, gilt es bereits als suspekt, wenn einer es fertig bringt, mehr als eine Kunstgattung zu beherrschen, oder zumindest auszuüben: Ich erinnere mich noch sehr deutlich der Zeit an der Akademie, als Herbert Boeckl mir gestattete, den Abendakt zu besuchen. Und wie er einmal bei seinen Inspizier-Rundgängen meine Zeichnungen betrachtete, und dann in seiner kärntnerischen Urart herausstieß: "Da Schauspüla kanns, und es blöden Maler könnts es net." Dieser Spruch aus dem Mund meines geliebten Boeckl ließ mich gewiß einige Zentimeter wachsen und beflügelte mich, spornte mich an zu zeichnen, zu malen und den oft recht trüben Theater-alltag zu bezwingen. Anstatt „Theaterkantinen-Ausrichtereien“ und Gasthaussitzungen betrieb ich meine Muse. Und wenn ich einmal im Beisl saß, dann fing ich mit dem Stift die "söligen" Gesichter ein, oder schöne Frauen. Ihnen galt mein besonderer Hang, und das hat sich bis heute nicht geändert.
Herbert Boeckl danke ich mein besseres Leben. Er hat mich erst richtig sehen gelehrte. Plötzlich entdeckte ich die verschiedenen grau und lila Schatten an einem Kanalgitter, oder ich betrachtete die Menschen ganz anders – und kam zu dem Punkt, daß eigentlich alles schön ist, was sich zeichnen läßt.
Ein Jahrzehnt nach dem Erlebnis mit Boeckl kam die Begegnung mit Oskar Kokoschka, dessen "Orpheus und Eurydike" ich in meinem Ateliertheater erstaufführte. OK drückte mir acht Entwürfe fürs Bühnenbild in die Hand, und riet mir, zum Unterrichtsminister zu gehen, um dort eine Finanzierung des Projekts zu erreichen. – Ich hab es noch heute im Ohr: "Sag dem Drimmel (damaliger Unterrichtsminister), wann er Dir nix gibt, komm ich nimmer nach Österreich." Mit den Entwürfen unterm Arm ging ich ins Unterrichtsminist-erium und zeigte die Schätze. Den Beamten fielen die Kinnladen herunter, und es ver-schlug ihnen die Sprache: Ein verrückter Theatermacher geht mit Millionen unterm Arm in Wien spazieren! Kurz: Der Unterrichtsminister warf mir dann einen Brocken hin. "Orpheus und Eurydike" wurde erstaufgeführt, und OK’s "Schule des Sehen" war für Salzburg gerettet.
Es war mir schwer Oskar Kokoschka davon zu überzeugen, daß ich nicht am Hungertuch nagte – jedesmal wenn wir uns im Beisl trafen, lud er mich auf ein Fleischlaberl oder ein Liptauerbrot ein, und ich mußte es essen – ob hungrig oder nicht. Beim Zahlen spätestens begann die Peinlichkeit für mich: OK: "Was machts?" – Kellnerin: "16 Schilling".
OK legte jedesmal einen Hunderter hin, und wenn die Kellnerin herausgeben wollte, sagte er: "schon guat". Die Blicke der Kellnerin trafen mich. Ich errötete wie ein Paradiesapfel, weil ich das Gefühl nicht los bekam, für den "Strichbuam" von OK gehalten zu werden."
1926 erblickte ich als Bub das Licht der Welt. Meine Mutter war eine schöne Frau. Zu meinem Leidwesen mußte ich aus Ersparnisgründen die Kleider meiner um ein Jahr älteren Schwester nachtragen. Und weil ich dazu auch ganz aus dem Gesicht meiner Mutter geschnitten aussah, mußte ich mir auf der Straße häufig „is das a scheens Mädi“ anhören, was mich jedesmal zum energischen Konter: „I bin ka Mädi, i bin a Bua!“ ausholen ließ.
Glücklicherweise hatte ich in meinem leidenschaftlichen Lebe viel Gelegenheit, diese Tatsache zu beweisen! Ich war immer verliebt, und das hat sich bis heute gehalten, bis zur Geli, meiner Frau. Schon als 14jähriger promenierte ich auf der Linzer Landstrasse (das ist so was Ähnliches wie der KU-Damm in Berlin) mit einer roten Liebhaber-Ausgabe von Shakespeares „Romeo und Julia“ und längerer Haarfrisur. Was damals zur Nazizeit häufig Anlaß zu Anpöbelung gab. Es störte mich nicht. Ich war fest überzeugt davon, daß „die Bretter, die die Welt bedeuten“ mir gehören würden.
Neben dem Gymnasium studierte ich Gesang am Bruckner-Konservatorium, wo ich mein erarbeitetes hohes C meinen Partnerinnen opferte, indem ich die schwierigsten Opern-duette mit ihnen quälte. Es war Krieg, und die Tenöre lagen irgendwo im Schützen-graben...
Dann kam meine große Zeit als Statist am Stadttheater. Meine erste Aufgabe war es, in der Goethe-Operette „Friederike“ einen Koffer der Starsoubrette nachzutragen. In der „Boheme“ durfte ich streng auf Fingerdruck des Inspizienten einen (damals jämmerlichen) Freßkorb auf die Bühne bringen.
1944. Zu meinem großen Glück wurde ich in diesem Jahr zweimal ernstlich krank und mußte ins Krankenhaus. Erst war es eine Mittelohroperation, und später im Jahr ein grauenvolles Tonsillen-Abzess, das mir heute noch weh tut, wenn ich daran denke. ABER: Jedesmal, wenn ich im Krankenhaus lag, erreichte mich die Einberufung zum Militär und damit zum Krieg. Man „stellte mich zurück“, wie das im Militärjargon hieß.
Unterdessen gelang es mir die Aufnahmeprüfung in die bedeutendste Schauspielschule Österreichs und Deutschlands zu bestehen. Als ich jedoch das Studium antrat, waren – kriegsbedingt – die Theater und auch die Schauspielschule des Burgtheaters (Max Reinhardt-Seminar durfte es erst wieder nach dem Krieg heißen) geschlossen. Statt Schauspiel lernten wir Zünder für Minen zu machen.
1945. Die Bomben kamen, die Russen donnerten schon vor den Toren Wiens, der Einberufungsbefehl zum Volkssturm kam. Ich hielt mich schon damals an den Zerrissenen: (1. Akt Ende) FLUCHT, eilige FLUCHT.
In Innsbruck schnappte mich die Waffen-SS und zerrte mich zum Wehrbezirkskommando. Man verfrachtete mich zu den Gebirgsjägern und damit wäre ich nun zum Kanonenfutter für die Amis auserkoren gewesen. Weil meine Freistellung im Wehrpass noch nicht ab-gelaufen war, bestand ich auf eine Nachuntersuchung. Der Stabsarzt, ein älterer Herr, betrachtete mich mageres Bürschlein:
„Was hast für einen Beruf?“
„Ich bin Schauspieler. Ich studiere am Reinhardt-Seminar in Wien.“
„Ah. Interessant. Was für rollen hast denn schon gelernt?“
„Den Carlos, den Romeo …“
„Als Romeo hab ich noch – ganz als Junger – den Kainz gesehen!“
„Waas, den Kainz?“
„Hast ihn noch drauf, den Romeo?“ „-JA!-„
„Dann leg los!“
Ich spielte um mein Leben. Ich starb den schönen Tod des Romeo. Lange Stille. Der Herr Stabsarzt war berührt. Mit schalkhaften Augen fragte er: „Wo tuts Dir denn weh?“ - „Bergsteigen kann ich schon wegen meinem Herzen nicht“,
So versuchte ich den harten Einsatz zu verhindern. Der Stabsarzt stempelte meinen Pass und setzte „zwei Monate verlängert“ ein. Dann drückte er mir den Wehrpass in die Hand und murmelte vor sich hin: „Bis dahin is alles vorbei. …“
Der gütige Stabsarzt hatte Recht. Der schaurige Spuk war vorbei. Vielleicht hat der Romeo mir eine lange Gefangenschaft erspart, vielleicht hat er mir sogar das Leben gerettet.
Im Sommer 1945 war ich bereits am LANDESTHEATER INNSBRUCK engagiert, spielte für die amerikanischen Besatzer in „Wiener Blut“ einen Kellnerpiccolo, der immer nur zu sagen hatte: „Is abserviert.“ Und im „Jedermann“ durfte ich der Spielansager neben Attila Hörbinger sein.
Der Hunger trieb mich nach Linz zurück zu meinen Eltern. Was machte ich: Ich ging sofort am ersten Abend wieder ins Theater, indem ich ja statiert hatte, und besuchte da einen Kollegen (einen Bassisten), der auch den „Ochsen von Lerchenau“ gesungen hatte, und man erzählte sich, wie man den Krieg überstanden hatte. Plötzlich stürzte der Oberspiel-leiter der Oper und Operette in die Garderobe und sagte:
„Hörns, Sie san do a Schauspüler. Ziagns Ihne schnell an. Der, der den Posthalter Binder spielen soll, der is heut mit dem Zug net angekommen. Der kommt sonst immer aus Enns, aber heut is der Zug net ankumma.“
Sag ich: „Ja, ich hab ja keine Ahnung wie das geht – was soll ich denn da machen?“
Sagt er: „Wir wern Dir alles erklären. Ziag Di schnell an.“
Also warf man mich in ein grünes Biedermeiergwandl, ich wurde noch geschminkt – und ein Kollege, mit dem ich die meisten Szene hatte, sagte: „Ich sag Dir alles. Hab nur gar keine Angst. Ich sag Dir alles. – Also jetzt gehst raus, und sagst: Ich möchte gern zum Franzl Schubert… und so und so… und da is die Alte, ja… Und dann gehst Du rauf, … und so…“
Also jedenfalls: Ich zog das durch. Ich wurde wieder jedesmal instruiert vor jeder Szene – habe improvisiert. Und in der Pause wurde ich dann noch in den Chorsaal gebeten, und da stand schon der Oberspielleiter und sagt: „Paß auf“ – er spielte auch mit, er spielte den alten Tschöll – und sagte: „Wenn ich mit dem Kopf nicke, singst Du: Jungfer Heiderl, sie gestatten, ihrem künftgen Ehegatten… ba-bababaa-bababaa-bababaaababa…“
Also, hab ich alles gemacht, zum Schluß noch getanzt. Und dann bin ich nach Hause gekommen, und meine Schwester, die kam auch etwas später nach Hause, und sagte: „Du, stell Dir vor, die Elfi Kammerstedter, stell dir vor, die hat gsagt, sie hätt Dich im Theater gsehn.“
Und ich sag: “Ja, ich habe gespielt.“
Am nächsten Tag war ich am LANDESTHEATER LINZ engagiert, und spielte sehr bald die schönste Rolle, die sich so ein junger Bursche mit 18 Jahren vorstellen kann – und zwar den Leon in „Weh dem, der lügt“.
Von dort gings bald nach Wien. An der INSEL in der Komödie, spielte ich unter Erich Ziegel, der noch Gründgens entdeckt hatte, und der mich für „Die beiden Veroneser“ ausgesucht hatte. Beim Vorsprechen sagte er, weil der Schauspieler ein Sonett singen sollte: „Kannst Du auch singen?“ – „Ja, selbstverständlich. Was wollen Sie hören?“ –
„Ja, was Du willst.“ – „Wollen Sie den Bajazzo hören?“ – „Ja, bitteschön .“
Und ich begann dann zu singen: „Lache Bajatscho“ – er unterbrach „Warum singst Du immer Bajatscho?“ – „Ja, wissen Sie Herr Ziegel, ich mach’s italienisch.“
Dann nach einem Jahr kam ich schon ans BURGTHEATER, zum ersten Mal ans Burg-theater, spielte mit Oskar Werner „Jugend“ von Max Halbe. Dann ein Stück, das hieß „Mit 18 Jahren“ – und dann bin ich meiner Partnerin in die Schweiz gefolgt, weil ich nicht mehr ohne sie leben wollte.
1948 spielte ich am ZÜRICHER SCHAUSPIELHAUS unter der Regie von Leohard Steckel Moretos „Donna Diana“ mit Maria Becker, Walter Richter, Leopold Biberti und Helen Vita, die nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Diseuse zu großem Ruhm ge-langte. Kennen Sie sie? Damals konnte ich ihre Wespentaille (als ihr Bühnenpartner) mit meinen beiden Händen sielend umfassen! … Na ja, so is es nun einmal. – Die Zeit… die Zeit… In Zürich war es auch, wo ich zum ersten Mal zwei Pastellbilder in einer kleinen Galerie ausstellte. Eines davon habe ich sogar verkauft.
1950 ging es wieder zurück nach Wien. Der große Karl Paryla engagierte mich an die SCALA. Ein Theater von höchstem Niveau. Ich lernte auch Bert Brecht kennen, und spielte bereits als zweite Rolle den Gigl in „Mädl aus der Vorstadt“ von Nestroy, … aber von der Direktion bis zum Portier waren sie alle Kommunisten… - und was mich besonders störte, sie benützten meine damals recht hübsche Larve. Ich mußte zum Beispiel am 1. Mai, dem Tag der Arbeit in der ersten Reihe winkend mit marschieren und das Prole-Prole-Prole-tariat lautstark hochleben lassen. Das gefiel mir gar nicht, und eh ich mich versah, war ich beim AMERIKANISCHEN TOURNEETHEATER gelandet. Ich spielte als Partner von Helene Thimig die Hauptrolle in „Die Strasse nach Cavarcere“ von Harald Zusanek.
Nach einem halbjährigen Gastspiel am LANDESTHEATER SALZBURG (dort portraitierte ich Oskar Kokoschka mit knappen Strichen im Weinhaus Moser. Damals ahnte ich noch nicht, daß uns 10 Jahre später ein freundschaftliches Verhältnis verbinden würde) verließ ich Österreich. Ich fand ein Engagement am RESIDENZTHEATER MÜNCHEN, wo ich an der Seite von Werner Hinz bei der Wiederentdeckung von Georg Kaisers „Kolportage“ eine wesentliche Rolle spielte. Dazu ein Zitat meines Regisseurs: „Mein lieber Relin, es ist alles recht und schön und gut was Sie machen, aber das Schloß, in dem Sie jetzt spiele, liegt in Schweden, und nicht in der Wachau!“
Dem Austriacischen in meiner Sprache wurde bald abgeholfen. Am STAATSTHEATER KASSEL, wo ich zwei Jahre blieb, spielte ich die schönsten und bedeutendsten Rollen meines Faches: Jugendlicher Held und romanischer Liebhaber. Unter der Regie von Albert Fischel, der ein außergewöhnlicher Regisseur war, der excellent Dialogregie führen konnte. Etwas Wesentliches, was am heutigen Theater sehr vernachlässigt wird.
Ich erhielt von den STÄDTISCHEN BÜHNEN FRANKFURT (von Harry Buckwitz und Lothar Müthel) ein Angebot, und es war für mich schwierig, aus dem Vertrag mit dem Staats-theater Kassel zu kommen. Man wollte mich um jeden Preis halten – man begann mich zu quälen… Bei der Generalprobe zu „Romeo und Julia“ platzte mir der Kragen. Ich warf dem Schauspieldirektor das bekannteste Goethe-Zitat von der Bühne in den Zuschauer-raum: „Herr Professor, sie können mich… (voll ausgesprochen) und tags darauf war ich in Frankfurt engagiert.
Dennoch war Kassel meine fruchtbarste Theaterzeit. Ich war bis in die letzten Fasern meines Talents gefordert worden. Dazu kam, daß ich im Malerischen sehr aktiv war. Ich hatte ein kleines Atelier. Ein Mitbewohner im selben Haus erhielt eines Tages Besuch. Der sprach mich im Stiegenhaus an. „Man erzählt sich fei, daß Sie auch malen? Hei,ei,ei,ei, … Kann man da nicht einmal was sehen?“… Stolz zeigte ich ihm meine „Werke“. – „… Hei,jei,jei – möchten Sie nicht einmal in Würzburg ausstellen? Ich hab da gute Bezieh-ungen …“ – Natürlich war ich von der Idee begeistert, und ein gutes Jahr darauf kam es zu einer der seltsamsten Vernissagen, über die ich noch berichten werde. Übrigens, der Hei,ei,ei heißt Joachim Schlotterbeck, gehört zum eingesessenen Inventar Würzburgs und er zählt zu meinen besten, untreuesten Freunden.
1954-58 Frankfurt: STÄDTISCHE BÜHNEN. Lothar Müthel gab mir viele schöne Auf-gaben: Den Arkenholz in „Gespenstersonate“, den Fürsten in „Bürger Schippel“… ich lernte Fritz Kortner kennen, teilte mir das Rollenfach mit Herrn Brinkmann – früher hieß er Klausjürgen Wussow.
Und ich begann wie ein Besessener zu malen, und meine Arbeiten auch öffentlich auszustellen.
Es kam zu jener von Joachim Schlotterbeck initiierten Ausstellung und Vernissage im WÜRZBURGER KUNSTKABINETT. Alles war bereit: Die überdimensionale Blumenvase, in der eine Erdbeerbowle der Gäste harrte, die Bilder hingen exakt ausgerichtet, Schlotter-beck war aufgeräumt, der Galerist und dessen heitere Mutter (mit dem Schöpflöffel für die Bowle in der Hand), und ein schmales Kritiker-Bürschlein im Trachtenanzug… Er hieß, soweit ich mich erinnere, Otto Schmitt… Heute heißt er (nachdem er sich über viele Verse und über den Pen-Club zu Höherem hinaufkatapultiert hat) Otto Schmitt-Rosenberger… Ich möchte ihn von dieser Stelle sehr herzlich grüßen…nicht zu vergeßen: Es kamen zwei Vernissagengäste: Ingeborg und Luigi Malipiero.
Die Erdbeerbowle wurde „geschafft“ – oder umgekehrt.
Es folgten zwei weitere Ausstellungen im Würzburger Falkenhaus – und ganz natürlich: Bei jedem Würzburg-Besuch war ein Abstecher nach Sommerhausen eine zärtliche Pflicht. Dort wartete ein junges, blondes, langhaariges Mädchen mit grünen Hosen auf mich! Manchmal steht sie jetzt noch vor dem Torturmtheater mit zwei „ausgewachsenen Kindern“ – sie kommt weit angereist, und wir lächeln uns zu.
Manchmal stehen Damen (so gut in den 50ern) an der Torturmkasse und lächeln, wenn sie mich sehen – und ihre Augen strahlen mit silbernem Blick. Auf den Wangen liegt ein roter Schimmer… Geli und Lörchen durchzuckt nur ein Stichwort: Kassel! Dann wird’s auch meinem alten Hirn klar: diese reifen Damen waren jene liebenswerten Teenager, die mir rote Herzchen vor dem Bühneneingang streuten, als ich am Staatstheater Kassel ihr Romeo oder ihr Carlos war.
1958 verließ ich Frankfurt, verabschiedete mich vom Theater und ging nach Wien zurück, wollte nur noch Maler sein. Mein großes Atelier in der Gumpendorferstrasse hatte mich wieder. Fünf Stockwerke – ohne Lift – hoch über dem Café Sperl, in dem noch Operet-tenkönige wie Franz Lehar Premieren feierten. Ich arbeitete für eine umfangreiche Aus-stellung in der ÖSTERREICHISCHEN STAATSDRUCKEREI (vorwiegend Ölarbeiten), die bei Presse und Publikum rege Beachtung fand, und die dazu führte, daß mich der Öster-reichische Kunstpapst Prof. Jörg Lampe ein Jahr darauf während der Wiener Festwochen mit den Ölbildern der Kandinsky-Gefährtin Gabriele Münter in einer Ausstellung verkuppelte.
Aber… wie es so geht… Die Dramaturgie des Lebens ist absolut unberechenbar! In meinem Atelier tauchte eines Abends ein mir befreundeter Regisseur auf, erzählte mir von seinem neuen Projekt: Satres „Fliegen“ für das kleine THEATER AM PARKRING, an dem schon Qualtinger gespielt hatte…
„Du mußt mir dafür ein kühnes Bühnenbild entwerfen, und Du mußt es auch selber malen! Das Theater hat kein Geld! – Malen… ja, das interessierte mich. Ich verkroch mich in ein Kellerloch am „Graben“ und warf mich in eine wilde Bühnenmalerei von eher tachistischem Charakter. Und ich war glücklich darüber, daß ich die malerische Scene bereits vor Probenbeginn vorzeigen konnte. Dann kam es zum Eklat. Einzig der für den Orest geplante Darsteller war mit der Abendgage von 90 Schilling nicht einverstanden! Er stieg aus! Eine Katastrophe! Und einen Orest gab es auch auf dem Naschmarkt nicht zu kaufen. Der Regisseur, die Schauspieler bettelten und beknieten mich: „BITTE Veit, spül Du den Orest!!“ - Es dauerte länger, ehe ich dann doch zusagte, und ich tat dies gewiß nur aus dem Grunde, weil ich nicht wollte, daß mein Bühnenbild in der Versenkung verschwindet. …Kurz, die „Fliegen“ wurden ein großer Erfolg.
Anschließend im THEATER DER COURAGE Andre Gides „Immoralist“. Die Theaterleiter köderten mich: „Spiel bei uns! Du darfst auch das Bühnenbild malen!“ … Und eh ich mich versah, war ich wieder am BURGTHEATER gelandet in Ernst Haeussermans neuer Ära. Wieder mußte ich mich dem Frondienst eines Staatstheaters unterwerfen. Viele gute, viele schlechte Rollen raubten mir die Zeit für die Ölmalerei. Allerdings ermöglichte mir das Burgtheater mein Portrait-OEvre enorm auszubauen. Kein Schauspieler mit Gesicht kam ungezeichnet davon: Die Thimigs, Wesselys, Hörbiger, Meinrad, bis hin zur blut-jungen Erika Pluhar, die öfter meine Partnerin war. Einen Bruchteil meiner Prominenten-Grafiken zeigte ich 1991 im HISTORISCHEN MUSEUM DER STADT WIEN, zu dessen Katalog mein Freund Dr. Viktor Matejka (der edelste Kommunist, den Österreich je hervorgebracht hat. Er machte als Kulturstadtrat Wien nach dem Kriege wieder international hoffähig) folgenden Beitrag verfaßt hat:
…Das Ateliertheater war vis-s-vis dem Naschmarkt, fast grenzte es an das traditionsreiche Theater an der Wien. Das war wie eine Herausforderung. Das siebenjährige Relin-Theater ist längst, wie man in Wien zu sagen pflegt, eine Legende geworden, auch wenn sie prägende und erregende Wirklichkeit war. Das heißt auch, was seither dort geschieht, ist alles andere als sensationell. Unter Veit Relin war dort eine Premiere ein von Presse und Publikum heiß verschlungenes Ereignis in der Wiener Theatergeschichte. Erstaufführungen gabs dort von Stücken eines Kokoschka und eines Picasso, vom international geschätzten Belgiers Ghelderode und vom Franzosen Vitrac. Auch Samuel Beckett, - um das Mutige, das Pionierhafte Veit Relins anzudeuten… Für mich bleibt Veit nach wie vor ein offener Geheimtip für den Wiener Reichtum.“
Na ja… sowas hört man eigentlich ganz gern…
Aber Sie sehen und hören, meine sehr verehrten Damen und Herren – und haben es gewiß gemerkt, daß ich schon wieder die Fluren der gesicherten Pensionierung und damit das Burgtheater verlassen habe, um einen kreativen Weg zu gehen.
Hin und wieder traf ich mich mit meinem alten Freund Schlotterbeck. Entweder in meinem Atelier in Schwabing (ich zeichnete ihn oft, er ist ein sehr illustres Modell und sitzt gut), oder ich besuchte ihn im Würzburger Falkenhaus. Fahrten ins Frankenland endeten meistens in Sommerhausen, zu dem ich eine besondere Affinität verspürte.
Herbst 1975. Steirischer Herbst – Grazer Festspiele. Ich spielte mit Krista Stadler in GESPENSTER von Wolfgang Bauer, als mich eine Nachricht aus Unterfranken erreichte: „Erwarten Sie am soundsovielten im Weinhaus Düll… Grüße, Michael Meisner“
Der Zufall oder das Geschick wollte es, dass ich zwischen zwei Vorstellungen Zeit hatte, die Reise nach Sommerhausen zu unternehmen. Präzise, wie es meine Art ist, wollte ich auch korrekt absagen. Jedenfalls hatte ich es fest vor…
Aber es kam ganz anders. Im Weinhaus Düll empfing mich eine illustre Runde… Der Landrat Wilhelm, der großartige Bezirkstagspräsident Franz Gerstner (einer der wenigen Politiker, der sich nicht nur als Förderer für den Torturm erwiesen hat – sondern einer, der auch die Vorstellungen besuchte) und der virtuos redende Michael Meisner, Träger nicht nur vieler Orden, sondern auch eines schönen, interessanten Kopfes. Er hatte gut über mich recherchiert, das imponierte mir mächtig. Dazu kam der gute Wein, und… na ja,… um „alle Irrtümer zu beseitigen“… es wurde auch noch eine sehr lebendige Nacht.
Nächsten Morgen, vor der Rückfahrt nach Graz, bummelte ich noch durch den Ort, durch die Schrebergärten beim Anker, als mir eine frisch geschnittene, gelborange Zinnie, die mitten auf dem Weg lag, ins Auge fiel. (Zinnien gehören zu meinen Lieblingsblumen.) Ich hob sie auf, steckte sie ins Handschuhfach meines Autos und fuhr gen Österreich. Und, stellen Sie sich vor, was dies Blume machte: Sie nickte mir ständig zu und sagte: Mach’s, mach’s! In Graz angekommen, war ich entschlossen, das Abenteuer Sommer-hausen einzugehen.
Ich suchte mir ein neues, interessantes Stück, gute Schauspieler und begann in meinem Münchner Atelier die Proben. Bei einem kurzen Abstecher nach Sommerhausen engagierte ich die legendäre Frau Stein, langjährige Mitarbeiterin von Luigi Malipiero, der die Theaterpraxis nicht fremd war. Und die mir wichtige Dienste leisten könnte, da ich in Sommerhausen sonst keine Bezugsperson hatte. Ich bat sie in meiner Abwesenheit erst einmal einen Telefonanschluß fürs Theater zu schaffen und fuhr wieder zu den Proben nach München. Und… ich höre und höre nichts von der Frau Stein: Wo ist sie wohl ab-geblieben? Besorgt fuhr ich wieder nach Sommerhausen. Der Bürgermeister Steinmann (der Vater des heutigen Bürgermeisters) händigte mir einen Brief und die Torturmschlüssel aus. Das war mein erster Schock.
Ich raste nach München und dann nach Wasserburg. Und erinnerte mich des Briefes einer Frau, die mir zur Übernahme des Theaters gratulierte… und, dass sie das Theater sehr liebt und hinter den Kulissen gerne mitarbeiten würde. – Zwei Tage lang suchte ich sehnsüchtig in der Autogrammpost nach jenen Zeilen, … und wurde fündig. Die Schrift war miserabel – dennoch rief ich sie an, ich hatte ja keine Wahl!
„Guten Tag, mein Name ist Veit Relin … ich möchte gerne eine Frau … ich kann den Namen nicht genau lesen … Hannelore … K—auf--hold sprechen.“ – Pause – „Sind Sie die Person?“ – Pause … „Ja“ (mit belegter Stimme). „Sie haben mir doch geschrieben, dass Sie gerne an einem Theater arbeiten würden. Pause... Stimmt’s?“ - Pause … „Ja“ - „Sind Sie motorisiert?“ - „Ja“. - „Dann setzen Sie sich gleich ins Auto und kommen in mein Atelier in München Schwabing.“ – „Heute geht’s nicht.“ –
„Wann dann?“ – „Morgen“. – „Okay“.
Als Hannelore Kaufhold die fünf Stockwerke zum Atelier hinaufschnaubte, und mir der frisch gefärbte Feuerball auf ihrem Kopf entgegenstrahlte, war mir klar, weshalb sie gestern keine Zeit hatte. Auch das – wahrscheinlich frisch gekaufte – graue Quelle-Kostüm lebt noch fest in meiner Erinnerung. Atemlos und totenbleich betrat sie das Atelier und ihr Gesicht glich einem wächsernen Opferstock, als sie die an die 100 Aktzeichn-ungen an den Wänden meines Ateliers betrachtete. Viel später erst beichtete sie mir den Grund für ihr Verhalten: Ihre Mutter (das liebe Omale) und ihre ganze Familie hielten den Telefonanruf für eine Finte und fürchteten, dass ihr Hannelörchen einer orientalischen Zuhälter-Mafia anheimfallen würde.
Unser Dialog war äußerst kurz: „Möchten Sie was trinken?“ – „Nein, danke.“ – „Können Sie putzen?“ – „Ja.“ – „Würden Sie, wenn das Klo verstopft ist, den Dreck mit Ihren Händen herausholen? – Das hab nämlich ich selber an meinem Wiener Theater öfter gemacht.“ – „Ja.“ – „Sind Sie ehrlich?“ – „Ja.“ – „Stehlen Sie?“ – „Nein.“ – „Können Sie rechnen? – Ich kann das überhaupt nicht. Bin in der Schule deswegen einmal sitzen geblieben.“ – „Kann ich.“ – „Also gut. Probieren wir’s auf drei Monate.“…
Dieses Jahr sind es 20 Jahre, dass wir miteinander sind. Ihre miserable Schrift hat sich inzwischen gebessert und manchmal versteht sie es sogar mit Fremdwörtern umzugehen.
Das Lörchen ist als Mensch, als Persönlichkeit, als wahrer Freund für mein Leben als einziger Glücksfall zu bezeichnen – auch fürs Theater, für Sommerhausen, fürs ganze Frankenland! … Das musste einmal ausgesprochen werden!
Das Eröffnungsspektakel mit Victor Haims „Wie man den Haifisch harpuniert“ war fulminant, und ich wusste, dass ich fest „rasseln“ musste, um überregionale Aufmerksamkeit zu erreichen.
Bei der zweiten Produktion „Die Blutschwestern“ machte ich exclusive Premieren, lukullisch verbrämt: Für Intellektuelle, für Arbeiter und für Rolls-Royce-Fahrer. Jeder der Theatergäste sollte ein, seinem Beruf adäquates Instrument mitbringen. Die Leute stiegen auf die Scherze ein: der Ohrenarzt kam mit seinem Spiegel, der Arbeiter mit einem Hammer oder Hobel. … Nur die Rolls-Royce-Fahrer verließen mich! Die Leute riefen an: „Wir haben einen 700er BMW, wir einen 600er Mercedes…“ Umsonst: Ohne Rolls-Royce keine Karte! Die Premiere drohte zu einem Fiasko zu werden – bis mir der Trick einfiel: „Gehen Sie in einen Kinderspielladen und besorgen Sie sich für zwei Mark einen Rolls-Royce!“ Damit war der Abend gerettet – viele Sommerhäuser Kinder erfreuten sich am Spielzeug. Und wir hatten Glück: Zur Premiere stand tatsächlich ein Rolls-Royce, ein schöner alter Jahrgang, direkt vor dem Theater. Er war fast so hoch wie der Torturm. – Und damit hatten wir unsere Geschichte im „Spiegel“. So kämpfte ich mit aller Raffinesse um Reputation.
Bald war es kein Kunststück mehr, am Wochenende ein gut besuchtes Haus zu haben. Mit „Wotans Baby“ von Bernd Grashoff wurden wir zu den MÜHLHEIMER THEATER-TAGEN eingeladen, was eine besondere Auszeichnung war (die besten Inszenierungen des Jahres). – Aber wie füllt man am Dienstag, Mittwoch und vor allem am Donnerstag das Theater! – die Gagen laufen weiter!
Helmut Krieger hieß er. Er war Polizist, später wurde er als Heimatdichter bekannt. Eines Tages sprach er mich vor dem Theater an und fragte, ob er für seine Polizei-Rotkreuz Hospitanten, die er ausbildete, einen Vorzugspreis bekäme. „Klar“, sagte ich: „Dienstag und Donnerstag wäre mir das sehr angenehm!“ So fing es an, auch an den so genannten schwachen Theatertagen im Torturm voll zu werden. Irgendwer erzählte mir, Helmut Krieger hätte in seinen Schulungsvorträgen mehr über die Inszenierungen im Torturm gesprochen, als über Erste Hilfe. Schade, dass es ihn nicht mehr gibt. Wir merken es auch an manchen Dienstagen!
An den Torturm
Unter den Zinnen
Trägst Du den Bauch
Heimlich aus Innen
Schwindelt sich Rauch.
Mund ist das Tor
Lanzenbewehrt
Weiniger Chor:
Das trojanische Pferd.
Musenumwandelt
Liebschaftverbandelt
Lasset uns danken:
Gott ist in Franken
In den fast 20 Jahren meiner Sommerhäuser Arbeit entstanden über 70 Inszenierungen, davon sehr viele Ur- und Erstaufführungen. Mit dem Uraufführungstrick zwinge ich die überregionale Presse zu uns zu kommen. Die Inszenierungen werden nicht nur in der Main-Post besprochen – man liest in der FAZ, der Süddeutschen, der Welt und anderen großen Blättern über uns. Dank Roland Thein auch in der dpa.
Seit ich ein leidenschaftlicher Frange bin, habe ich natürlich viel gezeichnet, viel gemalt und nicht nur Bühnenbilder. Hunderte Gesichter (viele Theaterbesucher oder Kinder, die während der Vorstellung babygesittet wurden), ich verliebte mich immer wieder aufs Neue in die Landschaft. Kalender entstanden in unterschiedlichen Techniken: Aquarell, Ölkreide, Hinterglasbilder – und damit waren auch Ausstellungen verbunden, von der Ott-Richter-Kunsthalle in Würzburg bis zur Jesuitenkirche in Aschaffenburg.
Mit dem wunderbaren fränkischen Maler Josef Versl verband mich und Geli eine tiefe Bindung. Ich habe ihn öfter gezeichnet oder kaltnadelradiert – und er mich. Zu seinem letzten Ölportrait saß ich ihm, und sein letztes Doppelportrait in Öl hat meine Geli, die er sehr liebte, und mich zum Inhalt. Eine große Aufregung und Faszination lag in diesem Nachmittag. Unvergesslich sein kreatives Stöhnen und die Laute, zu denen er seinen Körper aufbäumte, als malte er um sein Leben.
Die Freundschaft zu Schlo, meinem anderen Malerfreund in Würzburg ist nach wie vor akut. Er besucht vorzugsweise die Generalproben im Torturmtheater, was mir sehr recht ist, weil er sich häufig in leisesten Szenen hemmungslos räuspert. Damit hat er mir früher schon manche Premiere gefährdet. – Er ist nach wie vor lieb und treulos. Allerdings: Gestern erreichte mich ein Kartengruß aus Sizilien. … Dazu paßt ein Gedicht.
An Schlo
Pinienhain
Am Main
Das bist Du
Schlo.
Marocco
Gelber Sand
Einen Knaben an der Hand
Streunst Du
Abwärts zum Vesuv
Über Berge von
Tortellini.
Farben wie Aubergine,
Echtrotes Tomatenmark
Und der Rücken des Tintenfisches
Bewegen endlich Deine
Faule begabte Hand.
Dein Gaumen hat ein Blatt gemalt.
Deine Erde aber ist fränkisches Rot.
Du wirst immer wieder kommen.
Lebendig oder tot.
Pinienhain
Am Main
Das bist Du.
Schlo.
Zur stillen Torturmtheaterzeit, zu Weihnachten, jedes Jahr am Heiligen Abend geh ich mit meiner Geli zum Sommerhäuser Friedhof. Dort brennen wir für unsere Freunde, die uns in all den Jahren verlassen haben, Kerzen an. Dazu gehört vor allem meine Freundin, die berühmte Scherenschneiderin Irmingard von Freyberg. Sie war eine Freifrau, doch der Einfachheit halber nannten sie die Sommerhäuser Baronin. Das war ihr wurscht. sie war eine lebendige Legende mit viel Wissen und Kultur. Gabriele Münter hatte sie noch gemalt. Ihr zu lauschen bereitete mir viel Vergnügen – und sie lauschte auch mir sehr gerne. Manchmal tröstete sie auch weinende Mädchen.
Irmingard von Freyberg ist schuld, dass ich seit über 30 Jahren im schönsten Turm und im schönsten Freilichtwohnzimmer der Welt lebe. Sie kannte den Vorbesitzer der damaligen Ruine der profanierten Frauenkirche, und brachte mich mit den Erben zusammen. Vegelt’s Gott!
Der Turm
Wolken wie Schnee von fiebrigen Pappeln
Umkreisen den Turm.
Der Juni brütet schwüle Düfte.
Schießscharten
warten.
Unter den Tauben romanische Fenster.
Hand eines Richters in Silber gefasst.
Gedanken rennen, Kerzen brennen.
Schießscharten
warten.
Wie die Grotte von Capri das Bad in Blau.
Vom Hochwasser ein Bild aus farbigem Wachs.
Schneekacheln fangen dich ein.
Schießscharten
warten.
Dunkel ist das Schlafgemach, davor der Altan.
Will nicht die Geschichte fragen, wer da schlief.
Braun die Balken, grau die Gruft.
Schießscharten
warten.
Der Altarraum hat sein gotisches Fenster.
Verlorene Halme eines Vogels,
Der ein Nest bauen wollte.
In Schießscharten
warten Madonnen.
Die kleine fränkische Madonna mit den Wiener Biedermeierhänden, die mir vor fast 17 Jahren im Weinhaus Unkel begegnete, ist nun seit Jahren meine Frau. Was sie anlangt, wird kostbar. Ihre Fähigkeiten (sie beherrscht alle Techniken besser al die Mannsbilder), ihre Intelligenz, ihr Wissen um Echtheit, ihr ausgeprägter Wahrheitsdrang, der ihr oft von unlauteren Menschen Anpöbelungen bringt, ihr großes Kunstverständnis – ohne sie wäre das Torturmtheater auf diesem hohen Niveau nicht zu halten. Ihr … - Eine Laudatio darüber, würde den Abend gewaltig verlängern. Dabei habe ich bis jetzt ihre exquisite Kochkunst ausgeklammert. Nikolai Gedda lobte, anlässlich seines musikalischen Goethe-Abends und des darauf folgenden Essens Gelis Ente als das Beste, was er je gegessen hatte. War es nun eine Ente oder eine Gans… Nun, sie wird mir verzeihen. … Geli ist meine Muse und gleichzeitig meine härteste und damit beste Kritikerin. Sie behütet mich davor, in nicht standesgemäße Gefilde abzugleiten. Sie berät mich, sie verwöhnt mich unendlich, was einem Mann in meinem Alter besonders gut tut, und sie fordert mich täglich aufs Neue. Wir machten Bücher zusammen, sie reichte mir die Feder und die Tusche oder die Rötelstifte in der Savanne der Masai Mara, um die wilden Tiere live zu zeichnen. So entstand auch ein Film fürs ZDF und ein Kunstband, von ihrer Hand geformt. Es war vielleicht die größte Aufregung meines Lebens. – Afrika, Masai Mara. In Sommerhausen, im Frankenland ist meine Geli jedenfalls das größte Ereignis meines Lebens.
Letzte Liebe
Text folgt dem Unterfangen.
Oh, könnte ich Gefühle fassen!
Gleich Schuberts Franzen
In einer „Winterreise“ Lieder lassen.
Winterreise, Krähe, Leiermann
Oh, könnt ich Tränen nehmen.
Kristallgebunden, wahr und dann
Einnähen in mein Sehnen.
Vollenden, voll und enden.
Oh, Deine Kinderhände!
Und nicht ein Schicksal wenden.
Du – du. Ich – ich. Zwei. Ende.

Österreicher von Geburt - Franke aus Liebe

© 2024 Torturmtheater Sommerhausen
kartenbestellung@torturmtheater.de
Telefon: 09333-268

Torturmtheater
Veit Relin
Hauptstrasse 1
97286
Sommerhausen